Im ak empfiehlt Maike Zimmermann unser Buch „Extremwetterlagen. Reportagen aus einem neuen Deutschland“.
Zum Buch: https://www.verbrecherverlag.de/…/extremwetterlagen…/

Reportagen aus einem neuen Deutschland
Im ak empfiehlt Maike Zimmermann unser Buch „Extremwetterlagen. Reportagen aus einem neuen Deutschland“.
Zum Buch: https://www.verbrecherverlag.de/…/extremwetterlagen…/

„Wann haben wir gemerkt, dass wir in einem neuen Land leben? Und woran? Und wie lernen wir, gegen den Wind zu atmen, der sich unheilvoll zusammenbraut und mit scharfen Böen in die Lungen drückt?“
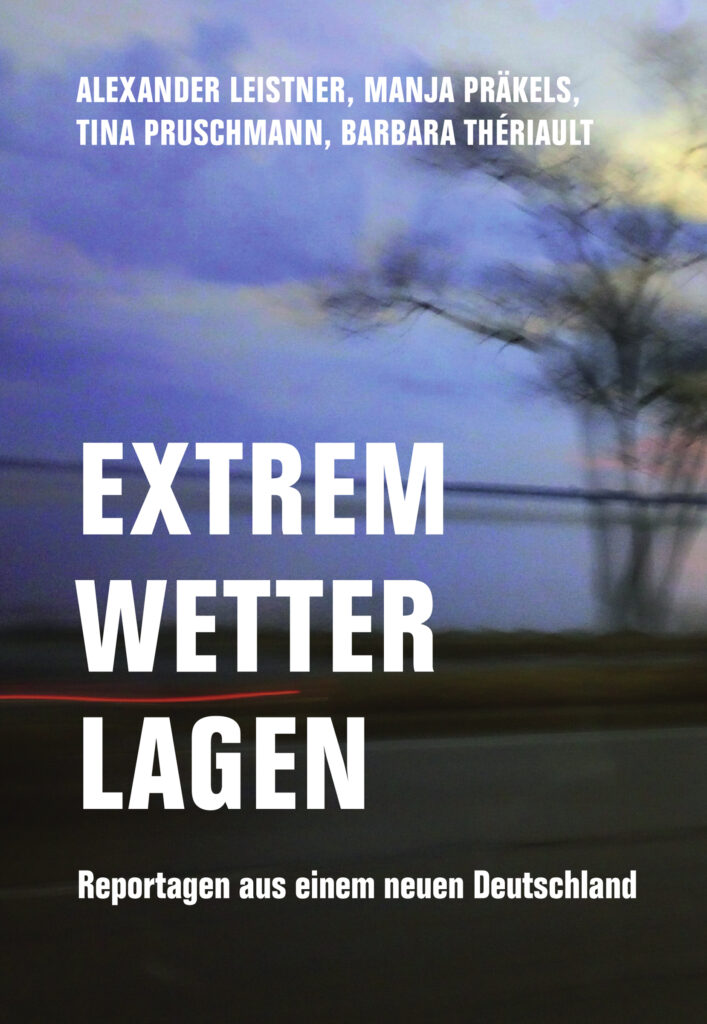
2024 startete ein ungewöhnliches literarisch-soziologisches Projekt. Mit Manja Präkels, Tina Pruschmann und Barbara Thériault wurden drei namhafte Autorinnen als „Überlandschreiberinnen“ ausgeschickt, um die Stimmung in Ostdeutschland zu ergründen, verborgene gesellschaftliche Brüche und Kipppunkte sichtbar zu machen. Während Manja Präkels gezielt zivilgesellschaftliche Initiativen und Brennpunkte in Brandenburg besuchte, bereiste Tina Pruschmann mit dem Fahrrad entlegene Regionen im sächsischen Erzgebirge. Barbara Thériault heuerte als Lokaljournalistin bei einer thüringischen Zeitung an, und Alexander Leistner folgte mentalen Entwicklungslinien, deren Anfänge teils noch vor 1989 zu verorten sind. So entstanden literarische Reportagen über die Normalisierung rechtsextremer Strukturen und Narrative, bedrohte Kulturvereine und Gedenkstätten, bizarre Infrastrukturprojekte in Ruinenlandschaften. Über Menschen, die wegsehen und schweigen, und solche, die tagtäglich ihr Bestes geben, um im tobenden Sturm der Umwertung aller Werte weiter gegen den Wind zu atmen.
Die Autor:innen präsentieren ihr Buch im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler und Autor Michael Bittner, der auch zum Organisationsteam des Festivals Literatur JETZT! gehört.

„Erinnerst Du Dich, wie leer die Stadt war, wie gespenstisch still, in den ersten Monaten der Pandemie? Ausgangssperren, eingeschränkte Kontakte?“
Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen. Wahrscheinlich hatte ich von einer meiner Fahrten durchs Land berichtet. Querfeldein. Vom Unterwegssein im entleerten Raum. Wir saßen in einer dieser wuseligen Nebenstraßen der Neuköllner Sonnenallee, unweit ihrer gerade noch bezahlbaren Einzimmerwohnung, als die Berliner Freundin von einer Furcht erzählte, die den Straßendörfern Brandenburgs galt. „Ich habe dort noch nie einen Menschen gehen sehen. Pandemie hin oder her.“ Sie assoziiere Zombiefilme oder andere postapokalyptische Stoffe mit diesen langgezogenen Siedlungsflecken, die sie regelmäßig auf dem Weg nach Norden, Richtung Ostsee, durchquere. Und ich gab ihr Recht.
Was sie da beschrieb, ist kein neues Phänomen. Auch keines, das nur die Dörfer betrifft. Doch seit wann ist das so? Was hat ihn ausgelöst, wie vollzog sich dieser offensichtliche Verlust von Gemeinschaft und Struktur des öffentlichen Lebens im ländlichen Brandenburg?
Foto: © Manja Präkels
Brandenburg steht voll mit ehemaligen Bunkern und Kasernen. Da waren die Preußen, die Nazis, die Rote Armee. Wie erinnert man daran?
Foto: © Manja Präkels
Manja Präkels – Rede, Poetische Positionen – im Rahmen der bundesweiten Veranstaltungsreihe DIE KUNST, VIELE ZU BLEIBEN des Fonds Darstellende Künste, gehalten 24. August 2024 auf dem Kunstfest Weimar.
WIE VIELE SIND WIR EIGENTLICH NOCH.
Der dort an der Kreuzung stand,
war das nicht von uns einer.
Jetzt trägt er eine Brille ohne Rand.
Wir hätten ihn fast nicht erkannt.
Wie viele sind wir eigentlich noch.
War das nicht der mit der Jimi-Hendrix-Platte.
Jetzt soll er Ingenieur sein.
Jetzt trägt er einen Anzug und Krawatte.
Wir sind die Aufgeregten. Er ist der Satte.
Wer sind wir eigentlich noch.
Wollen wir gehen. Was wollen wir finden.
Welchen Namen hat dieses Loch,
in dem wir, einer nach dem andern, verschwinden.
(Thomas Brasch, Poesiealbum 89)
Die Kunst, viele zu bleiben. Die Kunst, zu bleiben. Die Kunst, zu verändern. Das Recht, zu bleiben. Das Recht, mitzubestimmen. Eine Frage, die sich immer mehr Menschen an immer mehr Orten stellen: „Bleiben, oder gehen?“ Und dann sind da noch die, die fortmüssen. Die Armen, die mehr werden. Die nicht bleiben dürfen, wo und wer sie sind. Sie sind viele, aber es sind wenige, die darüber entscheiden.
Dort, wo ich herkomme, neigen die Verlassenen dazu, das Schiff zu versenken. Um nicht zurückzubleiben. Hinter den Erwartungen. Wessen eigentlich?
Meine Freunde und ich, eine kleine, radikale Minderheit von Weltverbesserern, Unangepassten, Luftmenschen, starrten jahrelang auf Fotografien von Aufmärschen, wie es sie heute wieder gibt, die nie vergangen sind. Auf die Hasser und Verachter, von denen es zu viele gibt. Immer. Neues Öl in alte Feuer.
„Guten Morgen, wie ist das werte Befinden? Sind wir heute eher brutal oder sentimental aufgelegt?“
Das kommt darauf an, was im Radio läuft. Herbert Roth? Rammstein? Dirk Michaelis? Gundermann? Die stille Rührung, die plötzlich entsteht, wenn eine Erinnerung geteilt wird. Mein Herz verschließt sich und der Kopf will fort. Zugehörigkeit als Gefängnis. Eingemauert in Ruinen. Allein mit der Frage, wo sich all die großen Gefühle verstecken, wenn es auf sie ankommt. Der Kältestrom, den alle kennen. So wie die Lieder. Alte Zeit. Saufen bis zur Taubheit. Blindheit. Bewusstlosigkeit. Ich weiß, dass das ungerecht ist. Aber was ist das nicht? Und alle habt ihr darauf Gift darauf genommen! Frieden, Freundschaft, Solidarität – wisst Ihr noch?
O, heilige Einfalt des Herzens! Einfaltspinsel. Striche in der Landschaft. Du ja. Du nein. Du raus. Du rein. Ihr passt hier nicht hinein.
Was sagt die Lehrerin den Kindern am Morgen? Warum wird Mina nicht mehr kommen? Sie hat die Mutter am Telefon gehabt. Gestern noch. Da fehlten ihr bereits die Worte. Für was eigentlich? Wie nennt man es, wenn Menschen ohne Anlass, ohne Grund aus ihrem Zuhause gerissen, gewaltsam und gegen ihren Willen in ein Flugzeug gesetzt und an einen Ort geschafft werden, den sie fürchten? Ein Mädchen. In Afghanistan. Jetzt.
Rückführungsverbesserungsgesetz.
Meine Nerven, das darf man ja gar keinem erzählen!
Das hat schon seine Richtigkeit.
Die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Wünschelrutengänger.
Die Körperbilder: KRAFTSTROTZEND oder MÜDE/VERLETZT.
Auf gepackten Koffern sitzen. Wegen der Polizei. Wegen der Nazis. Wegen dem Hass. Wegenwegenwegen. Wo ist zuhause, Vogelherz?
Winter is coming. / How winter kills.
Gedankenlosigkeit. Denkfaulheit. Das Fehlen von Neugierde.
DAGEGEN die konkrete Utopie:
DIE KUNST, ZU SCHAFFEN, WAS NOCH NICHT GEWESEN IST.
Die Vielen sind ja. Da. Sind arm, trotz Arbeit. Sind alt und raus. Auf der Flucht. Ohne sicheren Grund unter ihren Füßen. Sitzen allerorten, leise und beharrlich. Setzen sich ein. Beträumen die schöne Welt.
It’s expensive to be poor. Egal, wo man lebt. Wer einmal Hunger hatte, erkennt die Hungernden. Was geben wir preis, ohne uns einander erkennen zu geben? Erkannt, markiert, beurteilt werden – darin gibt es keine Gleichheit. Keine Zauberumhänge, die tarnen. Du kannst unsichtbar sein für die Güte. Für ihr Gegenteil bleibst du immer sichtbar.
Ich kenne diese Art Hunger nur vermittelt. Aus Familiengeschichten. Auf den weiten schattenlosen Flächen märkischen Ackers hatten einst meine Urgroßeltern ihre Rücken krumm gemacht. Bis die täglichen monotonen Verrichtungen sich schließlich so in ihre Körper eingeschrieben hatten, dass die gebeugte Haltung blieb. Margarethe Papajeweski war älter als mein Urgroßvater gewesen und schon schwanger, als sie sich trafen. Bei der Arbeit. In den Kartoffeln. Die Eltern hatten ihre Jüngste, für die kein Brot und auch kein Platz mehr war, in ihrer Hütte am Waldrand, kurz vor der russischen Grenze, in den Zug gen Westen gesetzt. Nach Brandenburg, wo sie Landarbeiter suchten.
Ihre bunten Stolas würden bis zuletzt von den Einheimischen belächelt werden. Dass sie nicht lesen konnte, fiel gar nicht auf. Von fünf Geburten kamen nur zwei durch. Aber sie hatten ein Auskommen für sich und die Kinder, für Stifte und Hefte, damit einmal ein besseres Leben anbräche. In der neuen Zeit, von der alle sprachen. Und in den Köpfen drehte sich der Plattenteller: „Mit dir, Lili Marleen“.
Auch meine Großmutter, kam aus dem Osten geflüchtet, ungewollt und mittellos. Ein altes Mädchen, übriggeblieben. Überflüssig. Hungerleider zu Hungerleider. Aber immerhin mit Volksschulabschluss.
Sie heiratete meinen Großvater am 07. Oktober 1949, dem neuen Staat zu Ehre und Treue. Damit es anders würde, besser, vor allem für die Kinder. Die wuchsen auf mit der Idee: Dieses Land gehört uns allen. Wie sie irrten. Unbeirrbar.
Es gibt Ecken in Brandenburg, da finden sie heute noch Knochen beim Pflügen. Einschusslöcher in den Bäumen. Geredet wird nur wenig. Keine Politik. Nichts Belastendes. Schlagermusik auf Friedhöfen. An deren Eingang steht: Wie ihr seid, sind wir gewesen. Wie wir sind, werdet ihr sein.
In Ostdeutschland, dem „Laboratorium der Demokratie“, wie es der Soziologe Steffen Mau genannt hat, gibt es auch Erfahrungsvorsprünge. Zum Beispiel im Nichthinterherkommen. Ein Lebensgefühl, das um sich greift, das Menschen aus den urbanen Räumen aufs Land hinaustreibt. Die stets Gebliebenen wundern sich, wurden die eigenen Kinder doch längst von Westprovinzen verschluckt und als zeitgemäß zugerichtete Verbraucherexistenzen in ihre kreditfinanzierten Reihenhäuser wieder ausgespuckt. Weit genug entfernt vom Ortsrand, wo die Kinder anderer Eltern auf ihrer Flucht aus den zerstörten Provinzen der Welt hinter Stacheldraht auf weißen Fluren hockend darauf warten, dass ein Gericht entscheidet, wer die Toiletten im Dorfgasthof putzen darf und wer nicht.
Ein Großteil der Menschen, die seit dem Mauerfall fortgingen, waren junge und gut ausgebildete Frauen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich anderswo einzusortieren. Männerüberschuss. Überschüssige Männer. Und so viele, die fehlen. Die sich woanders einbringen. Das Ungleichgewicht weiter verstärken.
Gewöhnung ist ein schleichendes Gift, Gleichgültigkeit der Zustand, der daraus resultiert.
Wie viele Elefanten passen in den Raum zwischen Frankfurt an der Oder und Frankfurt am Main? Dieses Land bleibt eines, in dem Menschen nach Belieben erschlagen werden können ob ihrer „Auffälligkeiten“ in Hautfarbe, Armut, Geschlecht, Sexualität, weiß der Himmel was. Auffälligkeiten als Abweichungen von einer fantasierten Norm, die nur sich selbst kennt. Eintopf. Manchmal jagen sie einen durch den Ort, weil es so langweilig ist, das eigene Leben. Zeit totschlagen, Menschen totschlagen. Damit sie einen nicht weiter durch ihre Anwesenheit belästigen. Die Zeit und die Menschen. Also besser: „Nicht auffallen! Keine Besonderheiten!“ Sie wissen schon. Das Gesetz der Lager, wie es der Kommunist und KZ-Überlebende Erwin Geschonneck formulierte. Vielleicht kennen Sie ihn aus der berühmten Verfilmung von Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“, in dem er als furchteinflößender Riese die schlagenden Herzen des Menschen durch solche aus Stein ersetzt. Steingärten. Nicht auffallen. Keine Besonderheiten. Ein Gesetz, das weiter gilt. Als Nährboden für die Landnahme der Menschenfeinde, die nicht erst beginnt, wenn die anstehenden Wahlen zum schlimmstmöglichen Ergebnis führen sollten. Denn sie hat längst begonnen. Die Landnahme. Der Weltraub.
Das Flüchten beenden wir so nicht. Die Stimmen der Geflüchteten werden wir nicht los. Ihre Fluchtrouten sind wie Erzählströme, die sich miteinander verbinden, die einander verschlucken, unberührt wieder ausspucken und aus unterirdischen Sphären ins Offene drängen um die verwüsteten Köpfe wieder urbar zu machen. Poeten, Sängerinnen, Geschichtenerzählerinnen und -erzähler reden, singen, schreiben dagegen an. Errichten Barrikaden aus Blättergrün, Meisenflaum, Zigarettenstummeln, um uns zu lehren, anders zu sehen. Und verzweifeln daran.
Ich wünschte, das Meer wäre das Meer und kein Friedhof. Ich wünschte, dieses Land wäre wie irgendein andres gutes Land. Ich wünschte, es wäre mein Land. Unser aller Land. Auch das Land der Frauen. Wir verlassen den Grund, der uns nicht gehört. Aber die Erde ist der einzige Planet, den wir bewohnen können. Planetarierinnen aller Länder. Bleibt unordentlich. Bleibt viele. In Unruhe. Damit es nicht mehr so weiter geht.
Damit dieses Land nicht weiter alle grau macht. Grauenhaft. Grausam. Entstellte Leute, kalt und sorgenvoll. We shall overcome? Schmeiß die Ironie über Bord und erinnere dich an morgen! Kommt, lasst uns Anker in die Zukunft werfen!
Ich höre vieler Menschen Schritte tasten –
verirrte Menschen, einsam, müd und arm –
und keiner weiß, wie wohl ihm wär und warm,
wenn wir einander bei den Händen fassten.
Erich Mühsam
Krieg, Abriss, Wegzug – die Stadt hat Lücken. Und Menschen, die dafür kämpfen, dass in diesen Lücken Platz für alle entsteht, die hier leben möchten.
Foto: © Manja Präkels
Drei Schriftstellerinnen dokumentieren Ihre Reisen durch Ostdeutschland vor den Wahlen. Manja Präkels beobachtet Rheinsberg in Brandenburg.
Foto: © Manja Präkels
© 2026 Extremwetterlagen
Theme von Anders Norén — Hoch ↑